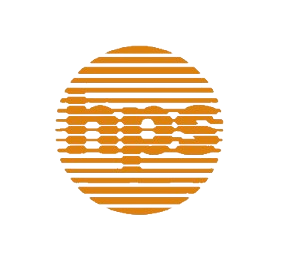Versuchshandbuch Einführung in die Steuerungstechnik
Artikelnummer: V0173-DE
- Versuchshandbuch für 2120, 2121.1
- Einführung in die Steuerungstechnik
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen der Steuerungstechnik
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Schaltungsunterlagen
- 1.2.1 Schaltpläne
- 1.2.2 Verdrahtungspläne
- 1.2.3 Kennzeichnung der elektrischen Betriebsmittel
- 1.2.4 Anschlussbezeichnung an Schützen, Tastern und ihre Bedeutung
- 1.2.5 Gebrauchskategorien
- 2 Übungen mit dem Contactor Control Board
- 2.1 Schützschaltung mit Taster und Meldeleuchte
- 2.1.1 ODER-Schaltung
- 2.1.2 UND-Schaltung
- 2.2 Schützschaltung mit Selbsthaltung
- 2.2.1 ODER-Schaltung
- 2.2.2 UND-Schaltung
- 2.3 Das Zeitrelais
- 2.3.1 Relais mit Anzugverzögerung
- 2.3.2 Relais mit Abfallverzögerung
- 2.3.3 Blinkschaltung
- 2.4 Schützverriegelung
- 2.5 Taster und Schützverriegelung
- 2.6 Folgesteuerung bei einer Fräse
- 2.6.1 Folgesteuerung eines Motors mit mechanischer Sperre
- 2.7 Fremdbelüfteter Motor
- 2.8 Torsteuerung
- 2.8.1 Erweiterte Torsteuerung
- 2.9 Werkzeugmaschine mit Schutzgitter
- 2.1 Schützschaltung mit Taster und Meldeleuchte
- 3 Übungen mit dem Contactor Board
- 3.1 Direktes Einschalten eines Motors
- 3.1.1 Direktes Einschalten eines Motors mit Anlaufüberbrückung
- 3.2 Wendeschaltung mit Schützverriegelung
- 3.2.1 Wendeschaltung mit Schütz- und Tasterverriegelung
- 3.3 Stern-Dreieck-Schaltung
- 3.3.1 Automatische Stern-Dreieck-Schaltung
- 3.3.2 Automatische Stern-Dreieck-Wende-Schaltung
- 3.4 Polumschaltung von Motoren
- 3.4.1 Polumschaltung von Motoren mit getrennter Wicklung
- 3.4.2 Motor mit direkter Drehzahlumschaltung
- 3.4.3 Polumschaltung mit Vorgabe der Drehrichtung
- 3.1 Direktes Einschalten eines Motors
- 1 Grundlagen der Steuerungstechnik
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Einführung in die Regelungstechnik
Artikelnummer: V0120-DE
- Versuchshandbuch für 5120
- Einführung in die Regelungstechnik
- 3. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Ziele und Inhalte der einzelnen Versuche
- 2. Einige wichtige Begriffe und Formelzeichen
- 3. Hinweise zur Meßtechnik
- 4. Beurteilung von Regelstrecken
- 5. Beurteilung von Reglern
- 6. Beurteilung von Regelkreisen
- Versuchsteil
- Regelstrecken
- 1. Regelstrecke mit P-Verhalten und Verzögerung 1. Ordnung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Proportionalbeiwert und Zeitkonstante einer Regelstrecke mit P-Verhalten und Verzögerung 1. Ordnung
- 2. Regelstrecken mit P-Verhalten und Verzögerung 3. Ordnung
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Proportionalbeiwert, Verzugszeit und Ausgleichszeit einer Regelstrecke mit P-Verhalten und Verzögerung 3. Ordnung
- 3. Regelstrecken mit I-Verhalten
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Anstiegsgeschwindigkeit und Integrierbeiwert einer Regelstrecke mit I-Verhalten
- 1. Regelstrecke mit P-Verhalten und Verzögerung 1. Ordnung
- Regler
- 4. P-Regler
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Proportionalbeiwert des P-Reglers
- 5. PI-Regler
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Nachstellzeit, Integrierbeiwert und Proportionalbeiwert des PI-Reglers
- 6. PD-Regler
- 6.1 Einleitung
- 6.2 Sprungantwort und Anstiegsantwort des PD-Reglers
- 7. PID-Regler
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Sprungantwort und Anstiegsantwort des PID-Reglers
- 8. Zweipunktregler
- 8.1 Einleitung
- 8.2 Schaltverhalten des Zweipunktreglers
- 4. P-Regler
- Regelkreise
- 9. P-T1-Regelstrecke, geregelt von einem P- und PI-Regler
- 9.1 Einleitung
- 9.2 Statisches Verhalten einer P-T1-Strecke, geregelt von einem P- und PI-Regler
- 9.3 Dynamisches Verhalten einer P-T1-Strecke, geregelt von einem P- und PI-Regler
- 10. P-T1-Regelstrecke, geregelt von einem Zweipunktregler
- 10.1 Einleitung
- 10.2 Einfluß des Sollwerts auf das Regelverhalten bei einer P-T1-Regelstrecke, geregelt von einem Zweipunktregler
- 10.3 Einfluß der Schaltdifferenz auf das Regelverhalten bei einer P-T1-Regelstrecke, geregelt von einem Zweipunktregler
- 11. P-T3-Regelstrecke, geregelt von einem P- und PD-Regler
- 11.1 Einleitung
- 11.2 Überblick über die einzelnen Größen beim Einsatz eines P-Reglers an einer P-T3-Strecke
- 11.3 Regelverhalten bei unterschiedlichen Proportionalbeiwerten und Nachstellzeiten beim Einsatz von P- und PD-Reglern an einer P-T3-Strecke
- 12. P-T3-Regelstrecke, geregelt von einem PID-Regler
- 12.1 Einleitung
- 12.2 Einfluß der Reglerkenngrößen auf die Regelgüte bei einer P-T3-Strecke
- 13. P-T3-Regelstrecke, geregelt von einem Zweipunktregler
- 13.1 Einleitung
- 13.2 Einfluß der Führungsgröße und der Schaltdifferenz des Zweipunktreglers auf die Regelgüte bei einer P-T3-Strecke
- 14. P-T3-Regelstrecke, geregelt von einem Zweipunktregler mit Rückführung
- 14.1 Einleitung
- 14.2 Zweipunktregler mit Rückführung als Oszillator
- 14.3 Vergleich der Regelgüte bei einer P-T3-Strecke, geregelt von einem Zweipunktregler mit und ohne Rückführung
- 15. I-Regelstrecke ohne und mit zusätzlicher Verzögerung, geregelt von einem P-Regler
- 15.1 Einleitung
- 15.2 Überblick über die Zusammenhänge im Regelkreis mit einer I-Strecke ohne Verzögerung, geregelt von einem P-Regler
- 15.3 Regelverhalten der I-Regelstrecke ohne und mit Verzögerung bei unterschiedlichen Proportionalbeiwerten des P-Reglers
- 16. Nachbildung eines Lageregelkreises in einer Werkzeugmaschine
- 16.1 Einleitung
- 16.2 Folgeverhalten der I-Regelstrecke mit einem P-Regler
- 17. Regleroptimierung nach Chien, Hrones und Reswick
- 17.1 Einleitung
- 17.2 Messungen zur Optimierung
- 18. Regleroptimierung nach Ziegler und Nichols
- 18.1 Einleitung
- 18.2 Messungen zur Optimierung
- 9. P-T1-Regelstrecke, geregelt von einem P- und PI-Regler
- Regelstrecken
- Einführung
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Leistungselektronik
Artikelnummer: V0124-DE
- Versuchshandbuch für 5125.10, 5125.11, 5125.12, 5125.13
- Leistungselektronik
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Versuchsanleitung Leistungselektronik V0124
- 1.1 Gleichrichterschaltungen
- 1.1.1 Ungesteuerte Gleichrichter
- 1.1.1.1 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1U
- 1.1.1.2 Zweipuls-Brückenschaltung B2U
- 1.1.1.3 Dreipuls-Mittelpunktschaltung M3U
- 1.1.1.4 Sechspuls-Mittelpunktschaltung B6U
- 1.1.1.5 Arithmetischer Mittelwert und Effektivwert
- 1.1.1.6 Pulszahl und Welligkeit
- 1.1.2 Gesteuerte Gleichrichter
- 1.1.2.1 Phasenanschnittsteuerung
- 1.1.2.2 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1C
- 1.1.2.3 Zweipuls-Brückenschaltung B2C
- 1.1.2.4 Halbgesteuerte Zweipuls-Brückenschaltung B2HZ
- 1.1.2.5 Dreipuls-Mittelpunktschaltung M3C
- 1.1.2.6 Sechspuls-Brückenschaltung B6C
- 1.1.2.7 Diac und Triac
- 1.1.2.8 Impulsgruppensteuerung
- 1.1.1 Ungesteuerte Gleichrichter
- 1.2 Pulsweitenmodulation
- 1.2.1 Einleitung
- 1.2.2 PWM-Signal und Tiefpassfilter
- 1.2.3 Gleichstromsteller (1–4 Quadrantenbetrieb)
- 1.2.4 2-Quadrantenbrücke
- 1.2.5 4-Quadrantenbrücke (H-Brücke)
- 1.2.6 Einfluss der PWM-Frequenz
- 1.2.7 Linearität einer H-Brücke
- 1.2.8 Wechselrichter in 2-Quadrantenbrücken
- 1.2.9 Wechselrichter in 4-Quadrantenbrücken
- 1.2.10 Sinusbewertete PWM
- 1.3 Gleichspannungswandler
- 1.3.1 Abwärtswandler (Step-Down Converter)
- 1.3.2 Aufwärtswandler (Step-Up Converter)
- 1.3.3 Umkehrwandler (Voltage Inverter Converter)
- 1.1 Gleichrichterschaltungen
- 2 Lösungsteil V0124
- 3 Theorie V0124
- 1 Versuchsanleitung Leistungselektronik V0124
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Regelstrecken / Regelkreise
Artikelnummer: V0122-DE
- Versuchshandbuch für 5130, 5131
- Regelstrecken und Regelkreise
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kenngrößen der Drehzahlregelstrecke
- 2 Kenngrößen der Temperatur- und Lichtregelstrecke
- 3 Der Motor mit Strom- bzw. Momentenregelung
- 4 Drehzahlregelung
- 5 Spannungsregelung mit einem Maschinengenerator
- 6 Drehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung
- 7 Gleichstrommotor am ungesteuerten und gesteuerten Einphasen-Einweg-Gleichrichter
- 8 Vierquadrantenbetrieb eines Gleichstrommotors mit einem Thyristor-Stromrichter
- 9 Vierquadrantenbetrieb mit einer H-Brücke
- 10 Elektronische Last
- 11 Temperaturregelung mit P- und PI-Regler
- 12 Temperaturregelung mit einem Zweipunktregler
- 13 Temperaturregelung mit PID-Regler und Impulsgruppensteuerung
- 14 Helligkeitsregelung mit P-, PI- und PID-Regler
- 15 Bode-Diagramm, Ortskurve und Regelbarkeit einer P-T3-Strecke
- 16 Anpassung und Glättung von Istwerten
- 17 Kenngrößen und Betriebsverhalten der Servo-Regelstrecke
- 18 Lageregelung
- 19 Lageregelung mit Einflußgrößen
- WNr 49019901 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Beleuchtungstechnik
Artikelnummer: V0111-DE
- Versuchshandbuch für 2102, 2103, 2104
- Beleuchtungstechnik
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen der Beleuchtungstechnik
- 1.1 Einführung
- 1.1.1 Elektromagnetische Wellen
- 1.1.2 Das menschliche Auge
- 1.2 Lichttechnische Grundgrößen
- 1.2.1 Lichtquellen
- 1.2.2 Normlichtarten
- 1.2.3 Spektrale Hellempfindlichkeit
- 1.2.4 Lichtstrom Φ
- 1.2.5 Lichtmenge Q
- 1.2.6 Raumwinkel Ω
- 1.2.7 Lichtstärke Ι
- 1.2.8 Beleuchtungsstärke E
- 1.2.9 Leuchtdichte L
- 1.2.10 Lichtstärkeverteilungskurve LVK
- 1.2.11 Kontrastwiedergabefaktor CRF
- 1.2.12 Lichtausbeute η
- 1.2.13 Beleuchtungswirkungsgrad ηB
- 1.2.14 Dimensionierung der Beleuchtung
- 1.2.15 Farbtemperatur TF
- 1.2.16 Farbwiedergabeindex Ra
- 1.3 Merkmale für gutes Licht
- 1.3.1 Faktoren für gutes Licht
- 1.3.2 Konditionierung und Raumklima
- 1.3.3 Beleuchtungsniveau
- 1.3.4 Harmonische Helligkeitsverteilung
- 1.3.5 Begrenzung der Blendung
- 1.3.6 Lichtrichtung und Schattigkeit
- 1.4 Lichtquellen
- 1.4.1 Allgemeines
- 1.4.2 Glühlampen
- 1.4.3 Halogen-Glühlampen
- 1.4.4 Niederdruck-Entladungslampen
- 1.4.4.1 Funktionsweise von Leuchtstofflampen
- 1.4.4.2 Start- und Zündvorgang von Leuchtstofflampen
- 1.4.4.3 Anwendung verschiedener Leuchtstofflampen
- 1.4.4.4 Natriumdampf-Niederdrucklampen (Na-Lampen)
- 1.4.5 Hochdruck-Entladungslampen
- 1.4.5.1 Natriumdampf-Hochdrucklampen
- 1.4.5.2 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
- 1.4.5.3 Mischlichtlampen
- 1.4.5.4 Xenondampf-Hochdrucklampen
- 1.4.6 Leuchtröhren
- 1.4.7 Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen)
- 1.4.8 Halogen-Hochdrucklampen
- 1.1 Einführung
- 2 Versuche zum Illumination Board
- 2.1 Kennwerte einer Glühlampe
- 2.2 Kennwerte einer Halogen-Glühlampe
- 2.3 Kennwerte einer Mischlichtlampe
- 2.3.1 Kennwerte
- 2.3.2 Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Aufwärmzeit
- 2.4 Kennwerte einer Kompaktleuchtstofflampe
- 2.5 Kennwerte einer Leuchtstofflampe
- 2.5.1 Zeit für Start- und Zündvorgang
- 2.5.2 Beleuchtungsstärke bei Betrieb mit Starter und EVG
- 2.5.3 Beleuchtungsstärke bei unterschiedlichen Umgebungseinflüssen
- 2.5.4 Leistungsverhältnisse bei Betrieb mit Starter
- 2.5.5 Dimmen einer Leuchtstofflampe
- 2.5.6 Stromkompensation
- 2.5.7 Kennwerte
- 2.6 Gegenüberstellung der Lampen des Illumination Board
- 3 Versuche zum Halogen Board
- 3.1 Kennwerte und Leistungsverhältnisse bei der Halogen-Niedervolt-Lampe
- 3.2 Kennwerte und Leistungsverhältnisse bei der Halogen-Niedervolt-Lampe mit erhöhtem Wirkungsgrad
- 3.3 Wirkungsgrad des Transformators bei unterschiedlicher Auslastung
- 3.4 Dimmen der Halogen-Niedervolt-Lampe
- 3.5 Dimmen der Halogen-Niedervolt-Lampe mit erhöhtem Wirkungsgrad
- 3.6 Einfluss von Leitungsquerschnitt und Leitungslänge
- 3.7 Einfluss einer gewickelten Leitung auf die Helligkeit
- 4 Versuche zum Special Lamp Board
- 4.1 Kennwerte einer Halogen-Hochdrucklampe
- 4.1.1 Kennwerte
- 4.1.2 Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Aufwärmzeit
- 4.1.3 Leistungsverhältnisse
- 4.2 Kennwerte einer Natriumdampf-Hochdrucklampe
- 4.2.1 Kennwerte
- 4.2.2 Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Aufwärmzeit
- 4.2.3 Leistungsverhältnisse
- 4.3 Kennwerte einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
- 4.3.1 Kennwerte
- 4.3.2 Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Aufwärmzeit
- 4.3.3 Leistungsverhältnisse
- 4.4 Gegenüberstellung der Lampen des Special Lamp Board
- 4.1 Kennwerte einer Halogen-Hochdrucklampe
- 5 Anhang
- 5.1 Wichtige Hinweise zu den Messungen
- 5.2 Verwendete Messgeräte
- 5.3 Literaturverzeichnis
- 5.4 Gegenüberstellung aller in diesem Handbuch verwendeten Lampen
- 1 Grundlagen der Beleuchtungstechnik
- WNr 49019901 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Handbuch Elektrische Schutztechnik
Artikelnummer: V0119-DE
- Versuchshandbuch für 2330
- Elektrische Schutztechnik
- 6. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hinweise zum Umgang mit dem SAFETY BOARD
- 2 Schutz gegen direktes und bei indirektem Berühren
- 2.1 Grundlagen
- 2.1.1 Wirkungsbereich von Körperströmen
- 2.1.2 Aktive Teile
- 2.1.3 Körper
- 2.1.4 Schutz gegen direktes Berühren (Basisschutz)
- 2.1.5 Schutz bei indirektem Berühren (Fehlerschutz)
- 2.1.6 Fehlerarten
- 2.1.7 Fehlerstrom IF
- 2.1.8 Fehlerspannung UF
- 2.1.9 Maximal zulässige Berührungsspannung UL
- 2.2 Versuchsteil
- 2.2.1 Direktes Berühren
- 2.2.2 Indirektes Berühren und geeignete Schutzmaßnahmen
- 2.1 Grundlagen
- 3 Sicherheit durch Schutzkleinspannung
- 3.1 Grundlagen
- 3.1.1 Schutzklassen für elektrische Betriebsmittel
- 3.1.2 Definitionen
- 3.1.3 Vorschriften für den Stromkreis
- 3.2 Versuchsteil
- 3.2.1 Berührungsspannung UB und Fehlerstrom IB
- 3.1 Grundlagen
- 4 Spartransformator
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Versuchsteil
- 4.2.1 Gefahren des Spartransformators
- 5 Überstrom-Schutzeinrichtungen
- 5.1 Grundlagen
- 5.1.1 G-Sicherungen
- 5.1.2 Auslösecharakteristiken und Anwendungen von LS-Schaltern
- 5.1.3 Schutzmaßnahmen und Netzformen
- 5.1.4 Der LS-Schalter des SAFETY BOARD
- 5.2 Versuchsteil
- 5.2.1 Überstrom-Schutzeinrichtungen im TN-C-System
- 5.2.2 Überstrom-Schutzeinrichtungen im TT-System
- 5.1 Grundlagen
- 6 Summenstromwandler
- 6.1 Grundlagen
- 6.1.1 Summenstromwandler
- 6.1.2 Induktionsspannung Uind
- 6.2 Versuchsteil
- 6.2.1 Ströme durch den Summenstromwandler
- 6.1 Grundlagen
- 7 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
- 7.1 Grundlagen
- 7.1.1 Allgemeines
- 7.1.2 Funktionsweise eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD)
- 7.2 Versuchsteil
- 7.2.1 RCD (FI-Schutzschalter)
- 7.1 Grundlagen
- 8 Schutzmaßnahmen im TN-System
- 8.1 Grundlagen
- 8.1.1 TN-Systeme
- 8.1.2 TT-Systeme
- 8.1.3 IT-Systeme
- 8.1.4 Schutzmaßnahmen in den Systemen
- 8.1.5 Zuordnungen der Schutzeinrichtungen zu den Systemen
- 8.1.6 Hauptpotenzialausgleich
- 8.1.7 Zusätzlicher Potenzialausgleich
- 8.1.8 Abschaltzeiten
- 8.1.9 Spannungsbegrenzung bei Erdschluss eines Außenleiters
- 8.1.10 Schleifenimpedanz ZS
- 8.2 Versuchsteil
- 8.2.1 Erdschluss eines Außenleiters
- 8.2.2 Bestimmung der Schleifenimpedanz ZS
- 8.2.3 Fehler im TN-System
- 8.1 Grundlagen
- 9 Schutzmaßnahmen im TT-System
- 9.1 Grundlagen
- 9.1.1 TT-System
- 9.1.2 Abschaltbedingungen
- 9.1.3 Erdung der Körper
- 9.2 Versuchsteil
- 9.2.1 Überprüfung des RCDs
- 9.2.2 Auslöseverhalten des RCDs in Abhängigkeit vom Erdungs- und Fehlerwiderstand
- 9.1 Grundlagen
- 10 Messen des Erdungswiderstandes
- 10.1 Grundlagen
- 10.1.1 Allgemeines
- 10.1.2 Strom-Spannungs-Messverfahren
- 10.2 Versuchsteil
- 10.2.1 Erdung über Erdungswiderstand RA
- 10.2.2 Direkte Erdung über Staberder
- 10.1 Grundlagen
- 11 Schutzmaßnahmen im IT-System
- 11.1 Grundlagen
- 11.1.1 Allgemeines
- 11.1.2 Isolationswächter
- 11.1.3 Abschaltbedingungen
- 11.2 Versuchsteil
- 11.2.1 IT-System mit einem Fehler
- 11.2.2 IT-System mit zwei Fehlern
- 11.1 Grundlagen
- 12 Schutzisolierung
- 12.1 Grundlagen
- 12.1.1 Allgemeines
- 12.1.2 Schutz gegen direktes Berühren oder Basisschutz
- 12.1.3 Sicherheitsbestimmungen für Isolierstoffumhüllungen
- 12.2 Versuchsteil
- 12.2.1 Isolationsfehler
- 12.1 Grundlagen
- 13 Schutztrennung
- 13.1 Grundlagen
- 13.1.1 Schutztrennung
- 13.1.2 Bedingungen für die Anwendung von Schutztrennung
- 13.2 Versuchsteil
- 13.2.1 Einfach-, Doppel- und Mehrfachfehler
- 13.1 Grundlagen
- 14 Erder
- 14.1 Grundlagen
- 14.1.1 Erder
- 14.1.2 Spannungstrichter
- 14.1.3 Erderspannung UE
- 14.1.4 Schrittspannung US
- 14.2 Versuchsteil
- 14.2.1 Spannungstrichter und Schrittspannung US
- 14.1 Grundlagen
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Handbuch Elektrische Schutztechnik und Netzsysteme
Artikelnummer: V0117-DE
- Versuchshandbuch für 2350
- Elektrische Schutztechnik und Netzsysteme
- 2.01 Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sicherheitshinweise beim Umgang mit den Boards
- 2 Grundlagen
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Wirkungen des elektrischen Stromes auf den Körper
- 2.3 Einwirkdauer des elektrischen Stromes auf den menschlichen Körper
- 2.4 Der elektrische Widerstand des menschlichen Körpers
- 2.5 Herz-Strom Faktor
- 2.6 Verhalten bei Unfällen
- 2.7 Übungen
- 2.7.1 Übung 1
- 2.7.2 Übung 2
- 3 Vorschriften
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Errichten elektrischer Anlagen
- 3.3 Aufbau der DIN VDE 0100
- 3.4 Übersicht über die Schutzmaßnahmen
- 3.5 Empfohlene Prüffristen
- 3.6 Prüfung nach VDE 0100 Gruppe 600
- 3.6.1 Besichtigen
- 3.6.2 Erproben und Messen
- 3.6.3 Prüfprotokoll und Übergabebericht
- 4 Begriffe und technische Grundlagen
- 4.1 Anlagen und Netze
- 4.2 Verlegearten für Kabel und Leitungen
- 4.3 Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen
- 4.4 Zulässiger Spannungsfall
- 4.5 Zählerschrank / Zählerplatz
- 4.6 Potentialausgleich
- 4.7 Erdung
- 4.8 Fehlerarten
- 4.8.1 Fehlerstrom
- 4.8.2 Fehlerspannung
- 4.8.3 Maximal zulässige Berührungsspannung
- 4.9 Überstrom-Schutzeinrichtung
- 4.9.1 G-Sicherungen
- 4.9.2 LS-Schalter
- 4.9.3 RCD, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
- 4.10 Netzformen
- 4.10.1 TN-System
- 4.10.2 TT-System
- 4.10.3 IT-System
- 4.11 Maximal zulässige Abschaltzeiten
- 4.12 Überspannungsschutz
- 5 Messung der Netzspannung
- 5.1 Messung der Spannungen im TN-C System / TT-System
- 6 Messung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter auf Durchgängigkeit und Niederohmigkeit
- 6.1 Sichtprüfung
- 6.2 Messung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter und der Erdungsanlage
- 6.3 Messung des Erdungswiderstandes
- 6.3.1 Messung des Erdungswiderstandes mit Sonde
- 6.3.2 Messung des Erdungswiderstandes ohne Sonde
- 6.3.3 Messen der Erderspannung
- 7 Schleifenimpedanz, Netzimpedanz und Kurzschlussstrom
- 7.1 Allgemeines
- 7.2 Messung der Schleifenimpedanz, Netzimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 8 Isolationswiderstand
- 8.1 Allgemeines
- 8.2 Messen des Isolationswiderstandes
- 9 Prüfen der Drehfeldrichtung
- 10 Prüfen der Fehlerstrom-Schutzschaltung (RCD)
- 10.1 Messen der Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit Nennstrom
- 10.1.1 Messen ohne Sonde
- 10.1.2 Messen mit Sonde
- 10.2 Messen des Auslösestroms bei der Fehlerstrom-Schutzschaltung
- 10.1 Messen der Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit Nennstrom
- 11 Abnahmeprüfung einer Wohnung im TN-System
- 11.1 Sichtprüfung
- 11.2 Durchgängigkeit und Niederohmigkeit der Schutz- und Potentialausgleichsleiter
- 11.3 Messen des Erdungswiderstandes
- 11.4 Messen der Spannungen UL-N, UL-PE und UN-PE
- 11.5 Messen der Schleifenimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 11.6 Messen der Netzimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 11.7 Messen des Isolationswiderstandes
- 11.8 Messen der Drehfeldrichtung
- 11.9 Messen der Berührungsspannung, der Auslösezeit und des Auslösestromes beim RCD
- 11.10 Erstellen des Abnahmeprotokolls
- 11.11 Fehlersuche in der elektrischen Anlage
- 12 Abnahmeprüfung einer Wohnung im TT-System
- 12.1 Sichtprüfung
- 12.2 Durchgängigkeit und Niederohmigkeit der Schutz- und Potentialausgleichsleiter
- 12.3 Messen des Erdungswiderstandes
- 12.4 Messen der Spannungen UL-N, UL-PE und UN-PE
- 12.5 Messen der Schleifenimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 12.6 Messen der Netzimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 12.7 Messen des Isolationswiderstandes
- 12.8 Messen der Drehfeldrichtung
- 12.9 Messen der Berührungsspannung, der Auslösezeit und des Auslösestromes beim RCD
- 12.10 Erstellen des Abnahmeprotokolls
- 12.11 Fehlersuche in der elektrischen Anlage
- 13 TN-System mit direkt geerdetem Verbraucher
- 13.1 Messen des Erdungswiderstandes
- 13.2 Messen der Spannungen UL-N, UL-PE und UN-PE
- 13.3 Messen der Schleifenimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 13.4 Messen der Netzimpedanz und des Kurzschlussstromes
- 13.5 Messen des Isolationswiderstandes
- 13.6 Messen der Drehfeldrichtung
- 13.7 Messen der Berührungsspannung, der Auslösezeit und des Auslösestromes beim RCD
- 14 IT-System
- 14.1 Allgemeines
- 14.2 Isolationswächter
- 14.3 Prüfen des Isolationswächters
- 14.4 Messen sämtlicher Spannungen im IT-System
- 14.5 Messen der Auslösezeit und des Auslösestroms beim RCD
- 14.6 Einzelner Fehler im IT-System
- 14.7 Mehrfachfehler im IT-System
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Handbuch FI-Sensitiv-Board
Artikelnummer: VF1258-DE
- Versuchshandbuch für F1258
- Auslöseverhalten unterschiedlicher FI-Schutzschalter
- 1. Auflage, Deutsch
- Erklärung und Aufgaben für das FI-Sensitiv-Board
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Handbuch Einbruch-Melde-Anlage
Artikelnummer: V0112-DE
- Versuchshandbuch für 2107
- Versuche zu einer Einbruch-Melde-Anlage
- 2. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einbrüche und was man dagegen tun kann
- 1.1 Einbruchspunkte
- 1.2 Einbruchsmethoden
- 1.3 Einbruchsdauer
- 1.4 Mechanische Sicherheitseinrichtungen
- 1.5 VdS- und Polizeirichtlinien
- 2 Grundlagen der EMA-Technik
- 2.1 Begriffe und Abkürzungen
- 2.2 Wer und wie wird alarmiert?
- 2.3 Internalarm
- 2.4 Externalarm
- 2.5 Falschalarm
- 2.6 Überwachungsmethoden
- 2.7 Meldergruppen
- 2.8 Energieversorgung von EMA und EMZ
- 2.9 Leitungen
- 3 Komponenten einer Einbruch-Melde-Anlage
- 3.1 Schließblechkontakte
- 3.2 Magnetkontakte
- 3.3 Erschütterungsmelder
- 3.4 Alarmfolien und Alarmglas
- 3.5 Abschlusswiderstand
- 3.6 Glasbruchmelder
- 3.7 Körperschallmelder
- 3.8 Öffnungsmelder
- 3.9 Überfallmelder
- 3.10 Fadenzugkontakte
- 3.11 Bildermelder
- 3.12 Kapazitive Feldänderungsmelder
- 3.13 Lichtschranken
- 3.14 PIR-Bewegungsmelder
- 3.15 Ultraschall-Bewegungsmelder
- 3.16 Mikrowellen-Bewegungsmelder
- 3.17 Dual-Bewegungsmelder
- 3.18 Alarm-Trittmatten
- 3.19 Akustische und optische Signalgeber
- 3.20 Übertragungsgeräte
- 3.21 Schalteinrichtungen
- 3.21.1 Blockschloss
- 3.21.2 Schlüsselschalter
- 3.21.3 Geistige Schalteinrichtung
- 3.22 Einbruch-Melde-Zentrale
- 3.23 Grafische Symbole
- 4 Meldergruppen des ALARM BOARDs
- 4.1 PIR-Bewegungsmelder
- 4.2 Glasbruchsensor
- 4.3 Magnetkontakte
- 4.4 Externer Schlüsselschalter
- 5 Die Einbruch-Melde-Zentrale des ALARM BOARDs
- 5.1 Der Betrieb von Meldelinien
- 5.2 Mögliche Störungen der EMZ
- 5.3 Einschalt- und Alarmverzögerung
- 5.4 Sicherung mit externem Schlüsselschalter
- 6 Beispiele für Einbruch-Melde-Anlagen
- 6.1 EMA – Beispiel 1
- 6.2 EMA – Beispiel 2
- 6.3 EMA – Beispiel 3
- 1 Einbrüche und was man dagegen tun kann
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Handbuch Brand-Melde-Anlage
Artikelnummer: V0113-DE
- Versuchshandbuch für 2108
- Versuche zu einer Brand-Melde-Anlage
- 2. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 1.1 Feuer und Rauch
- 1.2 Brandschutz
- 1.3 Brand-Melde-Anlagen
- 2 VdS-Richtlinien
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Anforderungen an eine BMA
- 2.3 Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen
- 2.4 Planung und Errichtung einer BMA
- 2.4.1 Alarmorganisation
- 2.4.2 Überwachungsumfang
- 2.4.3 Meldebereiche
- 2.4.4 Auswahl von automatischen Brandmeldern
- 2.5 Planung einer BMA
- 2.5.1 Brand-Melde-Zentrale (BMZ)
- 2.5.2 Meldebereiche
- 2.5.3 Meldergruppen
- 2.5.4 Alarmierungsbereiche
- 2.5.5 Übertragungswege
- 2.5.6 Anordnung von Handfeuermeldern
- 2.5.7 Anordnung von automatischen Handmeldern
- 2.5.8 Energieversorgung
- 2.6 Alarmierung
- 2.6.1 Fernalarm
- 2.6.2 Externalarm
- 2.6.3 Internalarm
- 2.7 Projektierung
- 2.7.1 Automatische Brandmelder
- 2.7.2 Vermeidung von Falschalarmen
- 2.7.3 Elektrische Leitungen
- 2.7.4 Energieversorgung
- 2.7.5 Vernetzte Brand-Melde-Zentralen
- 2.7.6 Übertragungseinrichtung (ÜE)
- 2.7.7 Signalgeber
- 2.7.8 Feuerlöschanlagen
- 2.7.9 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- 2.7.10 Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
- 2.7.11 Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit
- 2.8 Anlagendokumentation
- 2.9 Einbau und Installation
- 2.9.1 Melder
- 2.9.2 Verbindungen und Leitungsverlegung
- 2.9.3 Energieversorgung
- 2.9.4 BMZ
- 2.9.5 Übertragungseinrichtung
- 2.9.6 Feuerwehrbedienfeld
- 3 Komponenten einer Brand-Melde-Anlage
- 3.1 Rauchmelder
- 3.1.1 Ionisations-Rauchmelder
- 3.1.2 Zweikammer-Ionisations-Rauchmelder
- 3.1.3 Optische Rauchmelder
- 3.1.4 Durchlicht-Rauchmelder
- 3.1.5 Funk-Rauchmelder
- 3.2 Brand-Gasmelder
- 3.3 Wärmemelder
- 3.3.1 Thermo-Maximalmelder
- 3.3.2 Thermo-Differenzialmelder
- 3.3.3 Thermo-Differenzial-Maximalmelder
- 3.4 Flammenmelder
- 3.5 Nichtautomatische Brandmelder
- 3.6 Feuerwehr-Schlüsseldepot
- 3.7 Feuerwehr-Bedienfeld
- 3.8 Brand-Melde-Zentrale
- 3.9 Grundsätzliches zur Verbindung der Meldelinien mit den Meldern
- 3.1 Rauchmelder
- 4 Meldergruppen des FIRE ALARM BOARDs
- 4.1 Hauptmelder
- 4.2 Thermo-Differenzialmelder
- 4.3 Optischer Rauchmelder
- 4.4 Druckknopf-Brandmelder
- 4.5 Feuerwehr-Schlüsseldepot
- 5 Die Brand-Melde-Zentrale des FIRE ALARM BOARDs
- 5.1 Meldelinien
- 5.2 Alarmausgang
- 5.3 Steuerung des Schlüsseldepots über die BMZ
- 5.4 Überwachte Störungen
- 5.5 Komplette Feuerüberwachung eines Gebäudes
- 5.5.1 Automatische Melder
- 5.5.2 Druckknopf-Brandmelder
- 5.5.3 Druckknopf-Brandmelder, Hauptmelder und Schlüsseldepot
- 5.5.4 Komplette BMA mit dem FIRE ALARM BOARD
- 1 Allgemeines
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6 kg

Handbuch Grundschaltungen Installationstechnik
Artikelnummer: V0110-DE
- Versuchshandbuch für 2101
- Grundschaltungen Installationstechnik
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Hausinstallationstechnik
- 1.1 Schaltzeichen der Installationstechnik
- 1.1.1 Schaltzeichen für Leitungen und Rohre
- 1.1.2 Schaltzeichen für Übersichtsschaltpläne, Installationspläne und Stromlaufpläne
- 1.2 Starkstromleitungen
- 1.2.1 Schlüssel für harmonisierte Starkstromleitungen
- 1.2.2 Leitungen für feste Verlegung
- 1.3 Arten von Schaltplänen
- 1.3.1 Installationsplan
- 1.3.2 Übersichtsschaltplan
- 1.3.3 Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung
- 1.3.4 Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung
- 1.4 Der sichere Umgang mit dem Gerät
- 1.4.1 Sicherheitshinweise
- 1.4.2 Hinweise zum Schaltungsaufbau
- 1.4.3 Fehlersimulation
- 1.1 Schaltzeichen der Installationstechnik
- 2 Grundschaltungen der Hausinstallationstechnik
- 2.1 Ausschaltung mit Ausschalter
- 2.2 Ausschaltung mit Ausschalter und Steckdose
- 2.3 Ausschaltung mit Dimmer und Steckdose
- 2.4 Wechselschaltung
- 2.5 Wechselschaltung mit Steckdose
- 2.6 Sparwechselschaltung mit Steckdose
- 2.7 Kreuzschaltung
- 2.8 Kreuzschaltung mit Steckdose
- 2.9 Stromstoßschaltung mit Tastern
- 2.10 Treppenhaus-Zeitschaltung
- 2.11 Außenbeleuchtung mit Automatikwächter
- 1 Einführung in die Hausinstallationstechnik
- WNr 49019919 | Urs DE | Gew. 0,6 kg