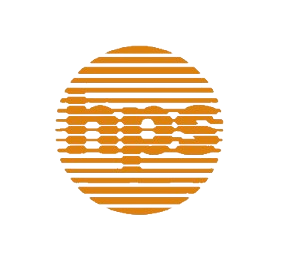Produkte
Handbücher

Versuchshandbuch Gleichstromtechnik
Artikelnummer: V0101-DE
- Versuchshandbuch für A1015, A1017.1, A1018.1, A1020
- Gleichstromtechnik
- 4. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Elektrischer Stromkreis
- 2. Ohmsches Gesetz
- 3. Spannungs- und Stromfehlerschaltung
- 4. Elektrische Widerstände
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Linearer Widerstand
- 4.3 NTC-Widerstand (Heißleiter)
- 4.4 PTC-Widerstand (Kaltleiter)
- 4.5 Spannungsabhängiger Widerstand (Varistor)
- 4.6 Fotowiderstand (LDR)
- 4.7 Reihenschaltung von Widerständen
- 4.8 Parallelschaltung von Widerständen
- 4.9 Mischung von Reihen- und Parallelschaltung
- 4.10 Unbelasteter Spannungsteiler
- 4.11 Belasteter Spannungsteiler
- 5. Ersatzspannungsquelle
- 6. Reihenschaltung von Spannungsquellen
- 7. Parallelschaltung von Spannungsquellen
- 8. Elektrische Leistung und Arbeit
- 9. Wirkungsgrad der elektrischen Leistung
- 10. Spannungs-, Strom- und Leistungsanpassung
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Wechselstromtechnik
Artikelnummer: V0102-DE
- Versuchshandbuch für A1017.1, A1018.1
- Wechselstromtechnik
- 4. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ermittlung und Darstellung von Kenngrößen in der Wechselstromtechnik
- 1.2 Kenngrößen der Sinusspannung
- 1.3 Wirkleistung bei Sinusspannung
- 1.4 Kenngrößen der Rechteckwechselspannung
- 2. Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom)
- 2.2 Spannungsverlauf bei Drehstromsystemen
- 2.3 Verbraucher in Sternschaltung
- 2.4 Verbraucher in Dreieckschaltung
- 2.5 Messungen an fehlerhafter Sternschaltung
- 2.6 Messungen an fehlerhafter Dreieckschaltung
- 3. Kondensator im Wechselstromkreis
- 3.2 Lade- und Entladevorgang eines Kondensators
- 3.3 Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung am Kondensator
- 3.4 Kapazitiver Blindwiderstand eines Kondensators
- 3.5 Reihenschaltung von Kondensatoren
- 3.6 Parallelschaltung von Kondensatoren
- 3.7 Blindleistung eines Kondensators
- 4. Spule im Wechselstromkreis
- 4.2 Ein- und Ausschaltvorgang an einer Spule
- 4.3 Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an einer Spule
- 4.4 Induktiver Blindwiderstand einer Spule
- 4.5 Reihenschaltung von Spulen
- 4.6 Parallelschaltung von Spulen
- 4.7 Blindleistung einer Spule
- 5. Zusammenschaltung von Widerstand, Kondensator und Spule
- 5.2 Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator
- 5.3 Parallelschaltung von Widerstand und Kondensator
- 5.4 Reihenschaltung von Widerstand und Spule
- 5.5 Parallelschaltung von Widerstand und Spule
- 5.6 Reihenschaltung von Kondensator und Spule
- 5.7 Parallelschaltung von Kondensator und Spule
- 5.8 Reihenschaltung von Widerstand, Kondensator und Spule
- 5.9 Parallelschaltung von Widerstand, Kondensator und Spule
- 5.10 Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- 6. Transformator, Übertrager
- 6.1 Grundlagen
- 6.2 Kopplungsgrad
- 6.3 Übersetzungsverhältnis
- 6.4 Widerstandstransformation
- 1. Ermittlung und Darstellung von Kenngrößen in der Wechselstromtechnik
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Halbleiterbauelemente
Artikelnummer: V0103-DE
- Versuchshandbuch für A1018.1
- Halbleiterbauelemente
- 4. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gleichrichterdioden
- 1.1 Wirkung des PN-Übergangs bei Dioden
- 1.2 Kennliniendarstellung von Dioden verschiedener Halbleiterwerkstoffe
- 1.3 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1
- 1.4 Zweipuls-Brückenschaltung B2
- 2. Z-Dioden
- 2.1 Durchlass- und Sperrkennlinie von Z-Dioden
- 2.2 Gleichspannungsbegrenzung mit Z-Dioden
- 2.3 Reihen- und Gegeneinanderschaltung von Z-Dioden
- 2.4 Wechselspannungsbegrenzung und Überspannungsschutz mit Z-Dioden
- 2.5 Spannungsstabilisierung mit Z-Dioden
- 3. Leuchtdioden
- 4. Bipolare Transistoren
- 4.1 Prüfen der Schichtung und des Gleichrichterverhaltens von bipolaren Transistoren
- 4.2 Stromverteilung im Transistor und Steuerwirkung des Basisstroms
- 4.3 Die Kennlinien des Transistors
- 4.4 Einfluss des Arbeitswiderstandes auf die Transistoreigenschaften
- 5. Unipolare Transistoren (Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren)
- 5.1 Prüfen der Schichtung und des Gleichrichterverhaltens von FETs
- 5.2 Durchlasskennlinie der PN-Übergänge des Gates bei FETs
- 5.3 Steuerwirkung des Gates beim N-Kanal-FET
- 5.4 Ausgangskennlinien des FETs
- 6. MOS-FET (IG-FET)
- 6.1 Steuerwirkung des Gates beim selbstsperrenden MOS-FET
- 6.2 Ausgangskennlinien des selbstsperrenden MOS-FETs
- 7. Unijunction-Transistor (UJT)
- 7.1 Prüfen der Interbasisstrecke beim Unijunction-Transistor
- 7.2 Schaltkennlinien des Unijunction-Transistors
- 7.3 Steuerkennlinien des Unijunction-Transistors
- 8. Thyristoren
- 8.1 Thyristordiode (DIAC)
- 8.2 Thyristortriode (Thyristor)
- 8.3 Zweirichtungsthyristor (TRIAC)
- 1. Gleichrichterdioden
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Grundschaltungen der Elektronik
Artikelnummer: V0104-DE
- Versuchshandbuch für A1018.1
- Grundschaltungen der Elektronik
- 4. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Verstärkerschaltungen
- 1.1 Verstärkergrundschaltungen mit bipolaren Transistoren
- 1.2 Verstärkergrundschaltungen mit Feldeffekt-Transistoren (FET)
- 1.3 Mehrstufige Verstärker
- 1.3.1 Zweistufiger Wechselspannungsverstärker
- 1.3.2 Darlington-Verstärker
- 1.3.3 Emittergekoppelter Verstärker
- 1.3.4 Phasenumkehrstufen
- 1.3.5 Differenzverstärker
- 1.3.6 Zweistufiger Gleichspannungsverstärker mit Komplementärtransistoren
- 1.4 Gegentaktendverstärker
- 1.5 Rückkopplung
- 1.5.1 Gegenkopplung
- 1.5.2 Mitkopplung
- 2. Kippschaltungen
- 2.1 Rechteckgeneratoren
- 2.1.1 Schwellwert-Schalter (Schmitt-Trigger)
- 2.1.2 Astabile Kippschaltung (Multivibrator)
- 2.1.3 Monostabile Kippschaltung
- 2.1.4 Bistabile Kippschaltung (Flip-Flop)
- 2.2 Sägezahngenerator (Pulsgenerator)
- 2.3 Sinusgeneratoren
- 2.3.1 Sinusgenerator mit RC-Glied
- 2.3.2 Sinusgenerator mit LC-Glied
- 2.1 Rechteckgeneratoren
- 3. Modulatoren und Demodulatoren
- 3.1 Amplitudenmodulator und -demodulator
- 3.2 Frequenzmodulator
- 4. Netzteilschaltungen
- 4.1 Gleichrichterschaltungen
- 4.1.1 Einpuls-Mittelpunktschaltung M1
- 4.1.2 Zweipuls-Brückenschaltung B2
- 4.1.3 Drehstromgleichrichter
- 4.1.4 Spannungsvervielfacher
- 4.2 Stabilisierungsschaltungen
- 4.2.1 Spannungsregler (linear)
- 4.2.2 Stromregler
- 4.2.3 Schaltspannungsregler
- 4.3 Gleichspannungswandler
- 4.1 Gleichrichterschaltungen
- 5. Schaltungen der Leistungselektronik
- 5.1 Anschnittsteuerung mit Thyristor
- 5.1.1 Anschnittsteuerung mit Gleichrichterwirkung
- 5.1.2 Anschnittsteuerung ohne Gleichrichterwirkung
- 5.2 Anschnittsteuerung mit TRIAC
- 5.3 Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter
- 5.4 Gleichspannungsschalter mit Thyristoren
- 5.1 Anschnittsteuerung mit Thyristor
- 6. Binäre Schaltglieder
- 6.1 UND-Glied
- 6.2 ODER-Glied
- 6.3 NICHT-Glied
- 6.4 NAND-Glied
- 6.5 NOR-Glied
- 7. Operationsverstärker
- 7.1 Invertierender Verstärker
- 7.2 Nichtinvertierender Verstärker
- 7.3 Summierer
- 7.4 Differenzverstärker
- 7.5 Dynamisches Verhalten
- Lösungsteil
- Anhang
- Verwendete Kurz- und Formelzeichen
- Zusammenstellung der steckbaren Bauelemente
- Erforderliche Spannungsversorgungen und Messgeräte
- 1. Verstärkerschaltungen
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Versuche zur Digitaltechnik
Artikelnummer: V0160-DE
- Versuchshandbuch für 3910, 3920, 3930
- Versuche zur Digitaltechnik
- 2. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Logische Grundschaltungen
- 1.1 Grundlagen
- 1.1.1 Darstellungsformen und Hilfsmittel
- 1.1.2 Gesetze der Schaltalgebra
- 1.1.3 Vollständige disjunktive Normalform
- 1.1.4 Vollständige konjunktive Normalform
- 1.1.5 KV-Diagramme
- 1.1.6 Logikfunktionen mit NOR- und NAND-Elementen
- 1.2 Versuchsteil
- 1.2.1 Wichtige binäre Verknüpfungen
- 1.2.2 Gesetze der Schaltalgebra
- 1.2.3 Disjunktive und konjunktive Normalform
- 1.2.4 Schaltungsentwurf mit Hilfe von KV-Diagrammen
- 1.2.5 Darstellung von Schaltnetzen in NAND-/NOR-Technik
- 1.2.6 Äquivalenz
- 1.2.7 Antivalenz
- 1.2.8 Arbeiten mit TTL-Bausteinen
- 1.1 Grundlagen
- 2. Schmitt-Trigger
- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Versuchsteil
- 3. Bistabile Kippstufen
- 3.1 Grundlagen
- 3.1.1 Allgemeines
- 3.1.2 Asynchrone Flipflops
- 3.1.3 Synchrone Flipflops
- 3.2 Versuchsteil
- 3.2.1 RS-Flipflop aus NOR-Gattern
- 3.2.2 RS-Flipflop aus NAND-Gattern
- 3.2.3 Taktzustandsgesteuerte RS-Flipflops
- 3.2.4 RS-Flipflops mit dominierendem S- oder R-Eingang
- 3.2.5 D-Flipflops
- 3.2.6 Einflankengesteuertes RS-Flipflop
- 3.2.7 Zweizustandsgesteuertes D-Flipflop
- 3.2.8 Einflankengesteuertes JK-Flipflop
- 3.1 Grundlagen
- 4. Monostabile Kippstufen
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 Versuchsteil
- 4.2.1 Das Monoflop des Digitalen Trainingssystems
- 4.2.2 Verzögerungsschaltungen
- 5. Codeumsetzer, Codierer
- 5.1 Grundlagen
- 5.1.1 Allgemeines
- 5.1.2 8421-BCD / 3-Exzeß-Codeumsetzer
- 5.2 Versuchsteil
- 5.2.1 8421-BCD / Dezimal-Codeumsetzer
- 5.2.2 8421-BCD / 7-Segment-Codeumsetzer
- 5.2.3 Codiererschaltungen
- 5.1 Grundlagen
- 6. Rechenschaltungen
- 6.1 Grundlagen
- 6.1.1 Allgemeines
- 6.1.2 Halbaddierer
- 6.1.3 Volladdierer
- 6.1.4 Korrekturaddition bei Dezimalzahlen
- 6.1.5 Subtrahierer für Dualzahlen
- 6.2 Versuchsteil
- 6.2.1 Halbaddierer
- 6.2.2 Volladdierer
- 6.2.3 Addierschaltungen für den 8421-BCD-Code
- 6.2.4 Halbsubtrahierer
- 6.2.5 Vollsubtrahierer
- 6.2.6 Subtrahierer für Dualzahlen
- 6.2.7 2-Bit-Parallel-Multiplikationsschaltung
- 6.2.8 Rechenwerk für 4-Bit-Dualzahlen
- 6.1 Grundlagen
- 7. Zählschaltungen
- 7.1 Grundlagen
- 7.1.1 Allgemeines
- 7.1.2 Asynchronzähler
- 7.1.3 Synchronzähler
- 7.1.4 Modulo-n-Zähler
- 7.1.5 Programmierbare Zähler
- 7.2 Versuchsteil
- 7.2.1 Asynchrone Vorwärtszähler
- 7.2.2 Asynchrone Rückwärtszähler
- 7.2.3 Asynchrone Umkehrzähler
- 7.2.4 Asynchrone Modulo-n-Zähler
- 7.2.5 Synchronzähler
- 7.2.6 Programmierbare Zähler
- 7.1 Grundlagen
- 8. Registerschaltungen
- 8.1 Grundlagen
- 8.1.1 Allgemeines
- 8.1.2 Schieberegister
- 8.1.3 Universalschieberegister
- 8.2 Versuchsteil
- 8.2.1 JK-Schieberegister
- 8.2.2 Schieberegister mit paralleler Dateneingabe
- 8.2.3 Serielle Datenübertragung
- 8.1 Grundlagen
- 9. Multiplexbetrieb
- 9.1 Grundlagen
- 9.2 Versuchsteil
- 10. Arithmetisch-logische Einheit
- 10.1 Grundlagen
- 10.1.1 Allgemeines
- 10.1.2 Zusammenwirken von ALU und Akkumulator
- 10.1.3 Rechenwerkbaustein 74HC / HCT181
- 10.2 Versuchsteil
- 10.2.1 Arithmetische Operationen
- 10.2.2 ALU mit Akkumulator
- 10.1 Grundlagen
- 11. Speicherschaltungen
- 11.1 Grundlagen
- 11.1.1 Allgemeines
- 11.1.2 Erweiterung der Wortbreite
- 11.1.3 Erweiterung der Anzahl der Speicherplätze
- 11.1.4 Speicherbausteine RAM 8x4 und EEPROM 8x4
- 11.2 Versuchsteil
- 11.2.1 Beschreiben und Lesen von Speicherbausteinen
- 11.2.2 Wortbreite
- 11.2.3 Speicherkapazität
- 11.1 Grundlagen
- 12. Analog-Digital-Umsetzer, Digital-Analog-Umsetzer
- 12.1 Grundlagen
- 12.1.1 Allgemeines
- 12.1.2 Analog-Digital-Umsetzer
- 12.1.3 Digital-Analog-Umsetzer
- 12.2 Versuchsteil
- 12.2.1 Analog-Digital-Umsetzung
- 12.2.2 Digital-Analog-Umsetzung
- 12.1 Grundlagen
- 1. Logische Grundschaltungen
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Versuche zum STEPPING BOARD
Artikelnummer: V0123-DE
- Versuchshandbuch für 5132
- Versuche zum STEPPING BOARD
- 2. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Die Entstehung der Drehbewegung
- 1.3 Maßnahmen für kleinere Schrittwinkel
- 1.4 Aufbau der Elektromagnete im Stator
- 1.5 Probleme von Schrittmotorsteuerungen
- 1.5.1 Die Steuerelektronik
- 1.5.2 Die Leistungselektronik
- 1.6 Mikroschritt- und Sinusbetrieb
- 2. Das Innenleben des STEPPING BOARD
- 2.1 Die Schrittfolge im Unipolarbetrieb
- Versuch 1: Betrieb über eine Strangwicklung
- Versuch 2: Betrieb über beide Strangwicklungen (abwechselnd geschaltet)
- Versuch 3: Betrieb über beide Strangwicklungen (gemeinsam geschaltet)
- Versuch 4: Betrieb über beide Strangwicklungen (gemeinsam und einzeln geschaltet)
- 2.2 Der Aufbau des Schrittmotors
- Versuch 1: Haltemomente, Raststellungen und induzierte Spannungen
- Versuch 2: Resonanzfrequenz und Dämpfung
- 2.3 Die Wicklungen des Schrittmotors
- Versuch 1: Ermittlung der Wicklungsdaten
- Versuch 2: Zeitkonstante und Einschaltstrom einer Wicklung
- Versuch 3: Wicklungsstrom und Grenzfrequenz
- 2.1 Die Schrittfolge im Unipolarbetrieb
- 3. Digitale Ansteuerungen des STEPPING BOARD
- 3.1 Motorbetrieb bei fest vorgegebener Schrittzahl
- Versuch 1: Steuerschaltung mit dem DIGI BOARD 2
- Versuch 2: Steuerschaltung mit DIGIwin
- 3.2 Translator für Vollschrittbetrieb mit Schieberegister
- Versuch 1: Einstrang-Vollschrittbetrieb mit dem DIGI BOARD 2
- Versuch 2: Einstrang-Vollschrittbetrieb mit DIGIwin
- Versuch 3: Zweistrang-Vollschrittbetrieb mit dem DIGI BOARD 2
- Versuch 4: Zweistrang-Vollschrittbetrieb mit DIGIwin
- 3.3 Translator für Vollschrittbetrieb mit Synchronzähler
- Versuch 1: Translator für Rechtslauf mit dem DIGI BOARD 2
- Versuch 2: Translator für Rechtslauf mit DIGIwin
- Versuch 3: Translator für Rechts- und Linkslauf mit dem DIGI BOARD 2
- Versuch 4: Translator für Rechts- und Linkslauf mit DIGIwin
- 3.1 Motorbetrieb bei fest vorgegebener Schrittzahl
- 4. Leistungselektronische Ansteuerungen des STEPPING BOARD
- 4.1 Schrittmotorbetrieb mit sinusförmigem Strom
- Versuch 1: Sinusförmige Pulsweitenmodulation mit ohmscher Last
- Versuch 2: Sinusförmige Pulsweitenmodulation mit induktiver Last
- Versuch 3: Sinusförmige Pulsweitenmodulation mit Rechteckspannung
- Versuch 4: Ströme und Brückenspannung der beiden Motorwicklungen
- 4.2 Drehzahl und Drehfrequenz bei sinusförmigem Motorstrom
- Versuch 1: Drehzahl und Drehfrequenz
- Versuch 2: Maximale Drehzahl und Drehrichtung
- 4.1 Schrittmotorbetrieb mit sinusförmigem Strom
- 5. Lösungsteil
- 5.1 Lösungen zu Kapitel 2.1
- 5.2 Lösungen zu Kapitel 2.2
- 5.3 Lösungen zu Kapitel 2.3
- 5.4 Lösungen zu Kapitel 3.1
- 5.5 Lösungen zu Kapitel 3.2
- 5.6 Lösungen zu Kapitel 3.3
- 5.7 Lösungen zu Kapitel 4.1
- 5.8 Lösungen zu Kapitel 4.2
- 6. Anhang
- 6.1 Kurz- und Formelzeichen
- 6.2 Literaturverzeichnis
- 6.3 Korrelationsmatrix – Übersicht der eingesetzten Geräte in den jeweiligen Versuchen
- 1. Grundlagen
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Transformatorschaltungen
Artikelnummer: V0171-DE
- Versuchshandbuch für 1103
- Transformatorschaltungen
- 1. Auflage, 3-phasig, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wissenswertes über Transformatoren
- 1.1 Übersicht über Transformatoren und deren Anwendungen
- 1.2 Prinzipieller Aufbau von Transformatoren
- 1.2.1 Aufbau des Kerns
- 1.2.2 Aufbau der Wicklungen
- 1.3 Das Leistungsschild als Benutzerinformation
- 1.4 Transformator-Schutzeinrichtungen
- 1.4.1 Schmelzsicherungen
- 1.4.2 Temperaturvollschutz
- 1.4.3 Thermometer
- 1.4.4 Buchholzschutz
- 1.5 Betriebsverhalten von Transformatoren
- 1.5.1 Betriebsverhalten im Leerlauf
- 1.5.2 Leerlaufspannung und Leerlaufstrom
- 1.5.3 Betriebsverhalten bei Belastung
- 1.5.4 Vereinfachtes Ersatzschaltbild und Zeigerdiagramm bei Belastung
- 1.5.5 Belastungsarten
- 1.6 Ein- und Ausschaltverhalten eines Transformators
- 1.6.1 Einschaltverhalten
- 1.6.2 Ausschaltverhalten
- 1.7 Kurzschlussspannung
- 1.8 Konstruktive Beeinflussung der Kurzschlussspannung
- 1.9 Kurzschlussstrom
- 1.10 Wirkungsgrad von Transformatoren
- 1.11 Parallelschaltung von Transformatoren
- 1.12 Beweis der Notwendigkeit von Transformatoren
- 2. 1-Phasen-Transformator
- 2.1 Leerlaufspannung
- 2.1.1 Leerlaufspannung des TRANSFORMER BOARD
- 2.2 Übersetzungsverhältnis
- 2.2.1 Übersetzungsverhältnis des TRANSFORMER BOARD
- 2.3 Strom- und Spannungsverhältnisse
- 2.3.1 Strom- und Spannungsverhältnisse bei Belastung
- 2.4 Ersatzschaltbild
- 2.4.1 Der ideale Transformator
- 2.4.2 Der Einfluss der Kupferverluste
- 2.4.3 Bestimmung des Ersatzwiderstandes
- 2.4.4 Der Einfluss der Streuung
- 2.4.5 Der Einfluss der Eisenverluste
- 2.5 Leerlaufkennlinie
- 2.6 Leerlaufverluste
- 2.7 Kurzschlussversuch (nur mit Stelltrafo durchführbar)
- 2.1 Leerlaufspannung
- 3. Spartransformator
- 3.1 Heruntertransformieren von Spannungen
- 3.1.1 Spartransformator im Leerlauf
- 3.1.2 Spartransformator bei Belastung
- 3.2 Hinauftransformieren von Spannungen
- 3.2.1 Spartransformator im Leerlauf
- 3.2.2 Spartransformator bei Belastung
- 3.1 Heruntertransformieren von Spannungen
- 4. 3-Phasen-Transformator
- 4.1 Drehstromsystem
- 4.2 Prinzipieller Aufbau von 3-Phasen-Transformatoren
- 4.3 Schaltungsarten und Bezeichnungen
- 4.4 Schaltgruppen
- 4.5 Bestimmung der Kennzahl
- 4.6 Absicherung des 3-Phasen-Transformators
- 4.7 Schaltgruppe Yy
- 4.7.1 Schaltgruppe und Kennzahl
- 4.7.2 Verhalten der Yy0-Schaltung bei symmetrischer Belastung
- 4.7.3 Verhalten der Yy0-Schaltung bei unsymmetrischer Belastung
- 4.7.3.1 Einsträngige Belastung der Yy0-Schaltung
- 4.7.3.2 Zweisträngige Belastung der Yy0-Schaltung
- 4.7.3.3 Einsträngige Belastung der YNy0-Schaltung
- 4.7.3.4 Zweisträngige Belastung der YNy0-Schaltung
- 4.8 Schaltgruppe Yd
- 4.8.1 Schaltgruppe und Kennzahl
- 4.8.2 Verhalten der Yd5-Schaltung bei symmetrischer Belastung
- 4.8.3 Verhalten der Yd5-Schaltung bei unsymmetrischer Belastung
- 4.8.4 Verhalten der YNd5-Schaltung bei unsymmetrischer Belastung
- 4.9 Schaltgruppe Yz
- 4.9.1 Schaltgruppe und Kennzahl
- 4.9.2 Verhalten der Yz5-Schaltung bei symmetrischer Belastung
- 4.9.3 Verhalten der Yz5-Schaltung bei unsymmetrischer Belastung
- 4.9.3.1 Einsträngige Belastung der Yz5-Schaltung
- 4.9.3.2 Zweisträngige Belastung der Yz5-Schaltung
- 4.9.3.3 Einsträngige Belastung der YNz5-Schaltung
- 4.9.3.4 Zweisträngige Belastung der YNz5-Schaltung
- 4.10 Schaltgruppe Dy
- 4.10.1 Schaltgruppe und Kennzahl
- 4.10.2 Verhalten der Dy5-Schaltung bei symmetrischer Belastung
- 4.10.3 Verhalten der Dy5-Schaltung bei unsymmetrischer Belastung
- 4.10.3.1 Einsträngige Belastung der Dy5-Schaltung
- 4.10.3.2 Zweisträngige Belastung der Dy5-Schaltung
- 4.11 Sonderschaltungen
- 4.11.1 Schaltgruppe Dd
- 4.11.2 Schaltgruppe Dz
- 4.11.3 Phasenvervielfacherschaltung
- 1. Wissenswertes über Transformatoren
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Einführung in die Analogtechnik
Artikelnummer: V0047-DE
- Versuchshandbuch für 3220
- Einführung in die Analogtechnik
- 3. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der einfache Differenzverstärker
- 2. Differenzverstärker mit Konstantstromquelle
- 3. Der Operationsverstärker µA 741
- 4. Inverter
- 5. Nichtinvertierender Verstärker
- 6. Impedanzwandler
- 7. Kompensation von Eingangsruhestrom und Offsetspannung
- 8. Additionsglied (Summierer)
- 9. Subtraktionsglied
- 10. Differenzspannungsverstärker
- 11. Konstantstromquellen und Spannungsstromwandler
- 12. Komparator (Schwellwertschalter)
- 13. Komparator mit Hysterese (Schmitt-Trigger)
- 14. Präzisionsspannungsquelle
- 15. Präzisionsgleichrichter ohne Schleusenspannung
- 16. Astabiler Multivibrator
- 17. Integrator
- 18. Dreieck- und Sägezahngenerator
- 19. Differenzierer
- 20. Monostabiler Multivibrator
- 21. RC-Oszillator mit Operationsverstärker
- 22. Wechselspannungsverstärker
- 23. Funktionsgeber
- 24. Quadrierer mit Diodennetzwerk
- 25. Radizierer mit Diodennetzwerk
- 26. Impulslängendiskriminator
- 27. Glättung mit Verzögerungsgliedern 1. und 2. Ordnung
- 28. Spannungs-Frequenz-Umsetzer (Analog-Frequenz-Umsetzer)
- 29. Analog-Digital-Umsetzer (ADU)
- 30. Digital-Analog-Umsetzer (DAU)
- 31. R-2R-Netzwerk als Digital-Analog-Umsetzer
- 32. Hybridmultiplizierer
- 33. Elektrisches Wattmeter
- 34. Dividierer
- 35. Radizierer
- Lösungsteil (L1–L57)
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Microcontrollertechnik
Artikelnummer: V0150-DE
- Versuchshandbuch für 3850
- Microcontrollertechnik
- 2. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Historie
- 1.2 Vergleich Microcontroller / Microprozessor
- 1.3 Microcontroller 80C535
- 1.3.1 Struktur
- 1.3.2 Speicherorganisation
- 1.3.3 Akkumulator
- 1.3.4 Programmstatuswort-Register (PSW)
- 1.3.5 B-Register
- 1.3.6 Stack Pointer (SP)
- 1.3.7 Data Pointer (DPTR)
- 1.3.8 Interrupt-System
- 1.3.9 Technik
- 1.3.10 Reset-Funktion
- 1.4 Kommunikation zwischen PC und MICROCONTROLLER BOARD
- 2 Programmierung des Microcontrollers 80C535 in BASIC
- 2.1 Funktionsweise der Programmierung in BASIC
- 2.1.1 Compiler-Modus
- 2.1.2 Terminalemulator (Monitormodus)
- 2.2 Programmierung der Ein-/Ausgabe-Ports in BASIC
- 2.2.1 Grundlagen
- 2.2.2 Übungsteil
- 2.3 Analoge Ausgabe über DA-Wandler in BASIC
- 2.3.1 Grundlagen
- 2.3.2 Übungsteil
- 2.4 Analoge Eingabe über AD-Wandler in BASIC
- 2.4.1 Grundlagen
- 2.4.2 Programmierung der SFR ADCON und DAPR
- 2.4.3 Übungsteil
- 2.5 Timer und ihre Funktionen
- 2.5.1 Grundlagen – Timer 0 und 1
- 2.5.2 Grundlagen – Timer 2
- 2.5.3 Übungsteil
- 2.6 Interrupt-Steuerung in BASIC
- 2.6.1 Grundlagen
- 2.6.2 Übungsteil
- 2.7 Serielle Schnittstelle des 80C535
- 2.7.1 Grundlagen
- 2.7.2 Übungsteil
- 2.8 Überwachungseinrichtungen des 80C535
- 2.8.1 Grundlagen
- 2.8.2 Übungsteil
- 2.9 EEPROM-Programmierung in BASIC
- 2.9.1 Grundlagen
- 2.9.2 EEPROM Befehlsübersicht
- 2.9.3 Übungsteil
- 2.10 Schrittmotorsteuerung mit dem STEPPING BOARD
- 2.10.1 Grundlagen
- 2.10.2 Übungsteil
- 2.1 Funktionsweise der Programmierung in BASIC
- 3 Programmierung des Microcontrollers 80C535 in Assembler
- 3.1 Bedienungshinweise Assembler
- 3.2 Befehlsübersicht Assembler
- 3.3 Programmierung der Ein-/Ausgabe-Ports
- 3.3.1 Grundlagen
- 3.3.2 Übungsteil
- 3.4 Analoge Ausgabe über DA-Wandler
- 3.4.1 Grundlagen
- 3.4.2 Übungsteil
- 3.5 Analoge Eingabe über AD-Wandler
- 3.5.1 Grundlagen
- 3.5.2 Programmierung der SFR ADCON und DAPR
- 3.5.3 Übungsteil
- 3.6 Timer und ihre Funktionen
- 3.6.1 Grundlagen – Timer 0 und 1
- 3.6.2 Grundlagen – Timer 2
- 3.6.3 Übungsteil
- 3.7 Interrupt-Steuerung in Assembler
- 3.7.1 Grundlagen
- 3.7.2 Interrupt-Freigabe
- 3.7.3 Interrupt-Zusatzfunktionen
- 3.7.4 Interrupt-Prioritäten
- 3.7.5 Übungsteil
- 3.8 Serielle Schnittstelle des 80C535
- 3.8.1 Grundlagen
- 3.8.2 Baudraten
- 3.8.3 Übungsteil
- 3.9 Überwachungseinrichtungen des 80C535
- 3.9.1 Grundlagen
- 3.9.2 Übungsteil
- 4 Programmierung des Microcontrollers 80C535 in C
- 4.1 Übungsteil
- 1 Einführung
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Phase-Locked-Loop
Artikelnummer: V0068-DE
- Versuchshandbuch für 4250
- Phase-Locked-Loop
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Prinzip und Grundlagen von PLL
- 1.1 Blockschaltbild PLL
- 1.2 Funktionsweise PLL
- 1.3 Phasenkomparator / Phasendetektor PD
- 1.3.1 Exklusiv-ODER-Gatter als PD
- 1.3.2 Flankengetriggertes JK-Flipflop als Phasendetektor
- 1.3.2.1 Der Tristate-Ausgang
- 1.4 Spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)
- 1.4.1 Einfacher Rechteckgenerator
- 1.4.2 Allgemeiner VCO
- 1.5 Tiefpass (TP)
- 1.6 Zwei Anwendungen des PLL
- 1.6.1 PLL-Frequenzsynthesizer
- 1.6.1.1 Die Referenzfrequenz
- 1.6.1.2 Die Frequenzteiler N1 und N2
- 1.6.2 Drehzahlregelung für einen Gleichstrommotor
- 1.6.1 PLL-Frequenzsynthesizer
- 2 Versuchsteil
- 2.1 Kennlinienaufnahme der beiden VCOs
- 2.2 Phasenschieber
- 2.3 Phasendetektor Typ I
- 2.4 Phasendetektor Typ II
- 2.5 Tiefpässe (Schleifenfilter)
- 2.6 Geschlossener Regelkreis, Ermittlung der Eigenphasenverschiebung
- 2.7 Halte- und Fangbereiche des PLL-Regelkreises
- 2.8 Ermittlung der möglichen Frequenzteilerwerte N1 und N2 des Frequenzsynthesizers
- 2.9 Dynamisches Regelverhalten des PLL
- 3 Lösungsteil
- 4 Anhang
- 4.1 Kurz- und Formelzeichen
- 4.2 Spezifikationen der verwendeten Messgeräte und Spannungsversorgungen
- 1 Prinzip und Grundlagen von PLL
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Filter- und Oszillatorschaltungen
Artikelnummer: V0136-DE
- Versuchshandbuch für 4075
- Filter- und Oszillatorschaltungen
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Passive Filter
- 1.1 Theoretische Einführung
- 1.2 Tiefpass mit RC-Glied
- 1.2.1 Grundlagen
- 1.2.2 Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses
- 1.3 Hochpass mit RC-Glied
- 1.3.1 Grundlagen
- 1.3.2 Grenzfrequenz eines RC-Hochpasses
- 1.4 Parallelschwingkreis mit LCR-Glied
- 1.4.1 Grundlagen
- 1.4.2 Resonanzfrequenz und Güte eines LCR-Parallelschwingkreises
- 1.5 Serienschwingkreis mit LCR-Glied
- 1.5.1 Grundlagen
- 1.5.2 Resonanzfrequenz und Güte eines LCR-Serienschwingkreises
- 2 Aktive Filter
- 2.1 Theoretische Einführung
- 2.2 Tiefpass 1. Ordnung
- 2.2.1 Grundlagen
- 2.2.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Tiefpasses 1. Ordnung
- 2.3 Tiefpass 2. Ordnung
- 2.3.1 Grundlagen
- 2.3.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Tiefpasses 2. Ordnung
- 2.4 Tiefpass 3. Ordnung
- 2.5 Tiefpass 4. Ordnung
- 2.6 Hochpass 1. Ordnung
- 2.6.1 Grundlagen
- 2.6.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Hochpasses 1. Ordnung
- 2.7 Hochpass 2. Ordnung
- 2.8 Bandpass 2. Ordnung
- 2.8.1 Grundlagen
- 2.8.2 Resonanzfrequenz und Güte eines Bandpasses 2. Ordnung
- 2.9 Bandpass mit variabler Güte
- 2.10 Notch-Filter
- 2.10.1 Grundlagen
- 2.10.2 Notch-Filter mit variabler Güte
- 2.11 Allpassfilter
- 2.11.1 Grundlagen
- 2.11.2 Phasenschieber mit Tiefpass 1. Ordnung
- 2.11.3 Variabler Phasenschieber
- 3 Digitale Filter
- 3.1 Theoretische Einführung
- 3.1.1 Kondensatoren im Takt
- 3.1.2 Universal-Dual-Filter
- 3.1.3 Hinweise zum Umgang mit dem Universal-Dual-Filter
- 3.2 Filterschaltungen 2. Ordnung
- 3.2.1 Tiefpass, Bandpass und Notch-Filter 2. Ordnung
- 3.2.2 Bandpass 2. Ordnung mit variabler Güte
- 3.3 Bandpass in Kaskadenschaltung
- 3.1 Theoretische Einführung
- 4 Oszillatoren
- 4.1 Theoretische Einführung
- 4.2 Quarzoszillatoren
- 4.2.1 Grundlagen
- 4.2.2 Ausgangsfrequenz eines Quarzoszillators
- 4.3 CMOS-Oszillatoren
- 4.4 Meißner-Oszillatoren
- 4.4.1 Meißner-Oszillator in Basisschaltung
- 4.4.2 Meißner-Oszillator in Emitterschaltung
- 4.5 Hartley-Oszillator
- 4.6 Colpitts-Oszillator
- 4.7 Spannungs-/Frequenzkonverter
- 4.7.1 Grundlagen
- 4.7.2 Kennlinie eines Spannungs-/Frequenzkonverters
- 4.8 Astabiler Multivibrator
- 4.8.1 Grundlagen
- 4.8.2 Dimensionierung eines astabilen Multivibrators
- 4.9 RC-Generator mit Operationsverstärker
- 4.10 Rechteck-/Dreieckgenerator
- 4.11 Sägezahngenerator
- 5 Anhang
- 5.1 Wichtige Hinweise zu den Messungen
- 5.2 Verwendete Messgeräte und Generatoren
- 5.3 Literaturverzeichnis
- 1 Passive Filter
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Modulationsverfahren Demodulatoren
Artikelnummer: V0131-DE
- Versuchshandbuch für 4281
- Modulationsverfahren Demodulatoren
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Theoretische Grundlagen der Modulationstechnik – Demodulation
- 2 Filterschaltungen
- 2.1 Theoretische Einführung
- 2.2 Messung des Frequenzgangs unterschiedlicher Tiefpassfilter
- 2.3 Messungen an einem Integrator
- 3 Amplitudenmodulation – Demodulation
- 3.1 Theoretische Einführung
- 3.2 Demodulation von AM-Signalen durch Hüllkurvengleichrichtung (inkohärentes Verfahren)
- 3.3 Demodulation von AM-ZSB-Signalen (kohärentes Verfahren)
- 3.4 Demodulation von AM-Einseitenbandsignalen
- 3.5 Demodulation von AM-Signalen mit PLL-Unterstützung
- 4 Winkelmodulationsverfahren – Demodulation
- 4.1 Theoretische Einführung
- 4.2 Demodulation frequenzmodulierter Signale mit einem C-Diskriminator
- 4.3 Demodulation frequenzmodulierter Signale mit einem Zähldiskriminator
- 4.4 PLL (Phase Locked Loop)
- 4.5 Demodulation frequenzmodulierter Signale mit einer PLL-Schaltung
- 4.6 Demodulation phasenmodulierter Signale mit einer PLL-Schaltung
- 4.7 Demodulation pulsfrequenzmodulierter Signale
- 5 Digitale Modulationsverfahren – Demodulation
- 5.1 Theoretische Einführung
- 5.2 Demodulation amplitudengetasteter Signale (ASK)
- 5.3 Demodulation frequenzgetasteter Signale (FSK) mit der PLL-Schaltung
- 5.4 Demodulation frequenzgetasteter Signale (FSK) mit dem C-Diskriminator
- 5.5 Demodulation phasengetasteter Signale (PSK)
- 6 Pulsmodulationsverfahren – Demodulation
- 6.1 Theoretische Einführung
- 6.2 Demodulation eines pulsamplitudenmodulierten Signals mit einem Tiefpass
- 6.3 Demodulation eines PAM-Signals mit Sample- and Hold-Stufe und Tiefpass
- 6.4 Zeitmultiplexverfahren
- 6.5 Demodulation eines Stereosignals mit einem Schalterdecoder
- 7 Pulscodemodulation – Demodulation
- 7.1 Theoretische Einführung
- 7.2 Übertragung von Gleichspannungswerten mit einem PCM-System
- 7.3 Übertragung eines sinusförmigen Signals mit einem PCM-System
- 7.4 Zeitmultiplexverfahren und PCM
- 7.5 Quantisierungsgeräusch
- 8 Deltamodulation – Demodulation
- 8.1 Theoretische Einführung
- 8.2 Demodulation deltamodulierter Signale
- 8.3 Steigungsüberlastung
- 8.4 Übertragung deltamodulierter Signale mit PSK
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Modulationsverfahren Modulatoren
Artikelnummer: V0130-DE
- Versuchshandbuch für 4280
- Modulationsverfahren Modulatoren
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Theoretische Grundlagen der Modulationstechnik
- 2 Addition und Multiplikation
- 2.1 Der Addierer
- 2.2 Der Multiplizierer
- 3 Amplitudenmodulation (AM)
- 3.1 Theoretische Einführung
- 3.2 Modulation an einer nichtlinearen Kennlinie
- 3.3 Amplitudenmodulation mit einem Multiplizierer
- 3.4 Spektrum und Bandbreite der AM
- 3.5 AM-ZSB mit unterdrücktem Träger
- 3.6 Der Multiplizierer im Gegentaktmodulatorbetrieb
- 3.7 Der Multiplizierer im Ringmodulatorbetrieb
- 3.8 Einseitenbandmodulation (ESB)
- 4 Winkelmodulationsverfahren
- 4.1 Theoretische Einführung
- 4.2 Erzeugung frequenzmodulierter Signale (FM)
- 4.3 Messung des Frequenzhubes
- 4.4 Ermittlung des Modulationsindexes
- 4.5 Frequenzspektrum einer FM-Schwingung
- 4.6 Erzeugung phasenmodulierter Signale (PM)
- 4.7 Erzeugung pulsfrequenzmodulierter Signale (PFM)
- 4.8 Erzeugung pulsphasenmodulierter Signale (PPM)
- 5 Digitale Modulationsverfahren
- 5.1 Theoretische Einführung
- 5.2 Erzeugung amplitudengetasteter Signale (ASK)
- 5.3 Spektrum amplitudengetasteter Signale
- 5.4 Erzeugung frequenzgetasteter Signale (FSK)
- 5.5 Spektrum frequenzgetasteter Signale
- 5.6 Erzeugung phasengetasteter Signale (PSK)
- 5.7 Spektrum phasengetasteter Signale
- 6 Pulsmodulationsverfahren
- 6.1 Theoretische Einführung
- 6.2 Erzeugung eines pulsamplitudenmodulierten Signals
- 6.3 Frequenzspektrum des pulsamplitudenmodulierten Signals
- 6.4 Erklärung des Abtasttheorems
- 6.5 Zeitmultiplexverfahren
- 7 Pulscodemodulation
- 7.1 Theoretische Einführung
- 7.2 Versuche am Pulscodemodulator
- 7.3 PCM-Multiplexbildung
- 8 Deltamodulation
- 8.1 Theoretische Einführung
- 8.2 Erzeugung deltamodulierter Signale (DM)
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Versuche zur abgeschirmten Leitung
Artikelnummer: V0135-DE
- Versuchshandbuch für 4284
- Versuche zur abgeschirmten Leitung
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Kennwerte einer abgeschirmten Leitung
- 3 Dämpfungsmessung entlang einer Leitung
- 4 Frequenzabhängigkeit einer Leitung
- 5 Eingangswiderstand einer Leitung bei Leerlauf, Kurzschluss und Anpassung
- 6 Stehende Wellen
- 7 Ausbreitungsgeschwindigkeit und Verkürzungsfaktor
- 8 Fehlerortung (Hochfrequenzmethode)
- 9 Impulsverhalten einer Leitung
- 10 Impulsreflektometrie
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg

Versuchshandbuch Lichtwellenleitertechnik
Artikelnummer: V0134.1-DE
- Versuchshandbuch für 4290, 4291
- Lichtwellenleitertechnik
- 1. Auflage, Deutsch
-
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Entwicklung der Lichtwellenleitertechnik
- 1.3 Das Prinzip der optischen Nachrichtenübertragung
- 1.4 Vorteile der Lichtwellenleitertechnik
- 1.5 Der Lichtwellenleiter (LWL)
- 1.6 Dispersion
- 1.7 Dämpfung
- 1.8 Sendeelemente
- 1.9 Empfangselemente
- 1.10 Steckverbindungen für Lichtwellenleiter
- 2 Der sichere Umgang mit den Geräten
- 2.1 Hinweise zum Arbeiten mit Geräten
- 2.2 Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Lasern
- 3 Versuche mit Lichtwellenleitern
- 3.1 Kalibrierungskennlinien der Empfangsdiode für Kunststofffasern
- 3.2 Leistungskennlinien von Sendedioden für Kunststofffasern
- 3.3 Kalibrierungskennlinie der Empfangsdiode für Glasfasern
- 3.4 Leistungskennlinie der Sendediode für Glasfasern
- 3.5 Dämpfungsmessung an Fasern
- 3.5.1 Grundlagen
- 3.5.2 Dämpfungsmessung an Kunststofffasern
- 3.5.3 Dämpfungsmessung an einer Glasfaser
- 3.6 Dämpfungsmessung an Verbindungsstellen
- 3.6.1 Grundlagen
- 3.6.2 Fehlersimulation mit der Optischen Bank
- 3.6.3 Fehlersimulation ohne Optische Bank
- 3.6.4 Leistungskennlinie einer Diode für Kunststofffasern mit Dämpfungsglied
- 3.6.5 Dämpfung einer ST-Glasfaserkupplung
- 3.7 Übertragung von Wechselspannung
- 3.7.1 Analogmodulation
- 3.7.2 Übertragung eines Sinussignals in Intensitätsmodulation
- 4 Störempfindlichkeit unterschiedlicher Übertragungsmedien
- 4.1 Allgemeines
- 4.2 Störempfindlichkeit einer Zweidrahtleitung
- 4.2.1 Allgemeines
- 4.2.2 Übertragung eines Sinussignals über eine Zweidrahtleitung
- 4.3 Leistungsanpassung
- 4.3.1 Allgemeines
- 4.3.2 Überprüfung des ausgangsseitigen Innenwiderstandes
- 4.4 Störempfindlichkeit einer Koaxialleitung
- 4.4.1 Allgemeines
- 4.4.2 Überprüfung der Störempfindlichkeit einer Koaxialleitung
- 4.5 Störstrahlung und Abhörsicherheit
- 4.5.1 Allgemeines
- 4.5.2 Abhören einer Zweidrahtleitung
- 5 Versuche mit Lasern
- 5.1 Allgemeines
- 5.2 Physikalisches Prinzip
- 5.3 Eigenschaften und Betriebsverhalten von Halbleiterlasern
- 5.3.1 Allgemeines
- 5.3.2 Strahlleistungs-Strom-Kennlinie
- 5.4 Spektrum
- 5.5 Modulation
- 5.6 Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Lasern
- 5.7 Technische Daten zur Laserdiode
- 5.8 Aufnahme der Laserdiodenkennlinie
- 5.9 Signalübertragung
- 5.10 Messung der Laserdiodenkennlinie mit dem Oszilloskop
- 6 Ausbreitungsgeschwindigkeit, Brechzahlindex und Numerische Apertur
- 6.1 Grundlagen
- 6.2 Ermittlung von Ausbreitungsgeschwindigkeit, Brechzahl und Einkopplungswinkel
- 7 Das Prinzip der Rückstreumessung
- 7.1 OTDRs / Reflektometer zur Fehlererkennung
- 7.2 Nachweis der Reflektion von Licht an Störstellen im LWL
- 8 Technische Daten
- 8.1 Sendediode (660 nm)
- 8.2 Sendedioden (850 nm)
- 8.3 Laserdiode
- 8.4 Kunststofffaser
- 8.5 Glasfaser
- 8.6 Empfangsdioden
- 1 Grundlagen
- WNr 49019900 | Urs DE | Gew. 0,6kg